
Keine Zeit zum Lesen?Alyftrek (VTD) ist der Nachfolger der bekannten Modulatorenkombination Kaftrio (ETI). VTD wird nur einmal täglich eingenommen und zeigt in Studien eine vergleichbare oder sogar stärkere Wirkung auf CFTR-Kanäle. Die Kosten pro Patient werden sich in Deutschland – entgegen anderslautender Gerüchte – kaum verändern. In Österreich und der Schweiz werden die Kosten noch ausgehandelt. Besonders interessant: Erste Rückmeldungen deuten darauf hin, dass neuropsychiatrische Nebenwirkungen unter VTD seltener oder schwächer auftreten könnten als unter ETI – vielleicht, weil VTD im Gehirn weniger stark wirkt, aber das ist reine Spekulation. Jedoch: Manche schienen gerade von den zentralnervösen Wirkungen von ETI zu profitieren, vielleicht würden sie diese unter VTD vermissen? Und viele weitere wichtige Fragen zu Nebenwirkungen und Umgang mit individuellen Reaktionen bleiben offen. Der Beitrag gibt einen persönlichen, fachlich fundierten Überblick – und stellt auch unbequeme, aber aus Sicht des Autors notwendige Fragen zur Zukunft der CF-Therapie, auch zur Dosierung. |
Ein persönlicher Kommentar von Kai-Roland Heidenreich*
Alyftrek (VTD) ist der Nachfolger von Kaftrio (ETI) – mit vereinfachter Einnahme, potenziell besserer Verträglichkeit und differenzierterer Wirkung. Erste Rückmeldungen zeigen Vorteile insbesondere bei neuropsychiatrischen Nebenwirkungen. Aber wie viel davon ist echter Fortschritt – und was bleibt spekulativ?
Mit der neuen Dreifachkombination aus Vanzacaftor, Tezacaftor und Deuteriertem Ivacaftor – kurz VTD, Handelsname Alyftrek – wird ein neues Kapitel in der Behandlung der Mukoviszidose (CF) aufgeschlagen. Nach dem riesigen Durchbruch durch ETI (Elexacaftor, Tezacaftor, Ivacaftor; EU-Handelsname Kaftrio stellt sich nun die Frage: Ist VTD tatsächlich die „bessere Kombination“? Und für wen?
VTD – Was ist neu an Alyftrek?
Chemisch ist die Sache klar: Vanzacaftor ersetzt Elexacaftor, das Ivacaftor wurde deuteriert – was zu einer längeren Halbwertszeit führt und eine einmal tägliche Gabe erlaubt –, Tezacaftor bleibt unverändert. Ein echter Vorteil der neuen Kombination ist die einmal tägliche Einnahme – nicht, weil Menschen mit CF nicht ohnehin schon ‚1000‘ Medikamente hätten, sondern weil dadurch die strikt einzuhaltende Einnahme mit 10–20 Gramm Fett flexibler gestaltet werden kann. Zum Beispiel können Frühstücksmuffel die Einnahme nun problemlos auf den Nachmittag oder Abend verlegen. Aber reicht das?
Zulassung: Mehr Menschen profitieren – aber nicht alle
Ein weiterer wichtiger Unterschied: Alyftrek ist für alle Menschen mit CF zugelassen, sofern sie nicht gleichzeitig zwei Klasse-I-mutierte CFTR-Allele aufweisen. Was leider auch weiterhin heißt, für ca. 15% Menschen mit CF, die exakt diese Konstellation aufweisen, haben wir immer noch keine systemisch wirkenden Heilmittel. Diese sozusagen liberalere Zulassung ist Ausdruck der ETI-Erfahrungen der letzten Jahre, wo sich gezeigt hatte, dass sich eine Wirkung bei deutlich mehr Menschen zeigen ließ, als nur jenen, wo die ursprüngliche Zulassung galt (insbesondere zuletzt F508del + beliebige zweite Mutation).
Erste Beobachtungen aus den USA: Mehr Wirkung, mehr Nebenwirkung?
In den letzten Jahren sind unter ETI neben den bekannten positiven Effekten auch zunehmend neuropsychiatrische Begleiterscheinungen beschrieben worden – darunter Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, kaum kontrollierbare Aggressivität, depressive Symptome oder kognitive Beeinträchtigungen wie „Brain Fog“.
Die Ursachen dafür sind bisher mangels auch nur ansatzweise ausreichender Forschung praktisch ungeklärt.
Ich kritisiere das seit langem, denn ich sehe hier einen Geburtsfehler der Orphan drug-Gesetzgebungen, den man meines Erachtens korrigieren könnte.
Es ist aber auch so, dass manche Menschen mit CF von ETI neuropsychiatrisch deutlich profitiert haben!
Nebenwirkungen unter ETI: Ein blinder Fleck?
Bei dieser Gelegenheit möchte ich mal einschieben: Meldestellen für Nebenwirkungen wirken auf mich zum Teil wie eine reine Abladestelle. Dafür zu interessieren scheint sich nicht wirklich jemand, wenn man daran denkt, dass aus gemeldeten neuropsychiatrischen Nebenwirkungen keine nennenswerten Folgen für die Designs der Zulassungsstudien zu Alyftrek entstanden waren.
Was also könnte die Ursache für die genannten zentralnervösen Reaktionen gewesen sein? Entweder handelt es sich um eine ungewollt „toxische“ Nebenwirkung auf das Gehirn (dagegen sprechen die oben genannten Fälle einer positiven Auswirkung!), oder es ist einfach die im Leben erstmalige deutliche Aktivierung der CFTR-Kanäle im Gehirn, die das biochemische Grundmilieu im Körper wie auch im Gehirn durcheinanderwirbeln – insbesondere, wenn der Körper zuvor viele Jahre an die CF-typische Stoffwechsellage angepasst war.
Sollte es keine „toxische“ Problematik sein – also dass Chemikalien unabhängig von der CFTR-Wirkung Effekte zeigen – dann halte ich Folgendes für denkbar: Je früher ETI – vielleicht sogar schon pränatal – eingesetzt werden kann, desto geringer ist der neuropsychiatrische Anpassungsdruck, der möglicherweise für einen Teil der unerwünschten zentralnervösen Begleiteffekte verantwortlich ist. Wenn Körper und Gehirn gar nicht erst mit den systemischen Folgen eines unbehandelten CF-Zustands in Kontakt kommen, sondern der korrigierte Zustand von Beginn an der physiologische Ausgangspunkt ist, könnten viele der beobachteten zentralnervösen Reaktionen ganz ausbleiben. Natürlich ist das spekulativ – aber um das zu klären, wäre es wichtig, psychosoziale und neuropsychiatrische Effekte künftig sauberer voneinander zu unterscheiden.
Die klinischen Daten zeigen: VTD ist mindestens so wirksam wie ETI. Der Schweißchloridwert sinkt unter VTD teils deutlich stärker – was nahelegt, dass die Kombination potenter auf zellulärer Ebene wirkt. Gleichzeitig berichten viele von Nebenwirkungen: Infektanfälligkeit, erhöhte Leberwerte, Abgeschlagenheit – aber qualitativ war das auch bei ETI schon so gewesen. Vielleicht gibt es Hinweise, dass diese Effekte bei VTD zugenommen haben.
Ein neuer Hoffnungsträger – auch fürs Gehirn?
Jetzt aber kommen (meine!) erfreulichen USA-Beobachtungen ins Spiel: Einige Patient:innen aus den USA, die unter ETI schwer mit neuropsychiatrischen Symptomen zu kämpfen hatten (so schwer, dass sie es absetzen mussten – mit teilweise sehr unguten Folgen für ihre Lungen), berichten unter VTD von einer merklichen Besserung, eher völligen Behebung der neuropsychiatrischen Problematik. Als mögliche Erklärung wird diskutiert: Vanzacaftor – der neue Korrektor in der Kombination – hat im Vergleich zu Elexacaftor vermutlich eine geringere Lipophilie bzw. höhere Polarität und könnte dadurch die Blut-Hirn-Schranke schlechter überwinden. Dadurch würde im Gehirn die Wirkung der Dreifachkombination deutlich abgeschwächt sein.
Zugewinn oder Verlust – je nach Wirkung auf die Psyche
Für genau jene, die unter ETI psychisch bzw. psychiatrisch instabil wurden, wäre das ein echter Fortschritt.
Aber umgekehrt gilt auch: Wer unter ETI neuropsychiatrisch profitiert hat – sei es durch bessere Stimmung, kognitive Wachheit oder reduzierte depressive Symptome –, könnte unter VTD genau diese zentralnervösen Effekte vermissen!
Depressionen (ursächlich könnten sowohl psychosoziale als auch neuropsychiatrische Schwierigkeiten sein) wurden in den neuen Studien zwar häufiger benannt, allerdings spricht vieles dafür, dass diese Klasse der Nebenwirkung bei ETI einfach nicht systematisch genug abgefragt wird. Wie so oft, so sieht es auch bei VTD aus, als sei es ein Zugewinn für die einen, aber ein Verlust für die anderen.
Subjektive Eindrücke und der Umgang mit Nebenwirkungssignalen
Ich beobachte seit Jahren, dass viele Patient:innen durch ETI sehr profitieren – aber nicht alle. Und: Der Preis für die Wirkung ist nicht für alle gleich. Schlaflosigkeit, Reizbarkeit, depressive Symptome, kognitive Beeinträchtigungen – all das wurde berichtet. Wenn VTD hier besser abschneidet, wäre das ein echter Zugewinn.
In letzter Zeit gibt es zudem einzelne (!) Hinweise auf einen möglichen Wirkverlust von ETI – sowohl bezogen auf den Salzgehalt des Schweißes als auch auf die Lunge (aber letzteres nicht immer!), denen übrigens unbedingt Fall für Fall nachgegangen werden sollte. Denn es gibt dabei auch „Fälle“, wo die Medikamentenspiegel in Ordnung waren!
Subjektive Erfahrungen: Warnsignal statt Störgeräusch
Was mich dabei generell zunehmend beschäftigt: Wie leichtfertig wird mit solchen Signalen umgegangen! Viel zu oft werden Hinweise auf Nebenwirkungen vorschnell als „nicht belegbar“ oder „nicht kausal“ abgetan – obwohl sie in ihrer Häufung längst Muster erkennen lassen. Gerade weil es bislang kaum langfristige, unabhängige Beobachtungsstudien gibt, die neuropsychiatrische Effekte im Alltag differenziert erfassen – auch deshalb, weil weniger als 5 % der CF-Zentren überhaupt über das nötige neuropsychiatrische Know-how verfügen, um solche Surveillances durchzuführen – wäre es umso wichtiger, systematisch zu dokumentieren, was Betroffene schildern. Erfahrungswissen ist kein Störfaktor, sondern ein Frühwarnsystem. Es wird Zeit, dass wir das ernst nehmen!
Überdosiert durch Einheitsdosis?
Besonders interessant finde ich: Manche Patient:innen – und auch einzelne Ärzt:innen haben das festgestellt – melden unter einer Verringerung der ETI-Dosis bessere Laborwerte (Schweißchlorid), bessere Verträglichkeit – und keine erkennbare Einbuße bei der Lungenfunktion, manchmal sogar eine Verbesserung – ist das nicht verrückt?
Warum Dosierungsfragen endlich gestellt werden sollten
Das wirft Fragen auf: Bei wie vielen Menschen wird eigentlich in diesem Sinne „überdosiert“? Warum bietet niemand an, Modulatoren fein abgestuft zu testen? Wenn ein Medikament wirkt, dann muss es nicht immer „Vollgas“ sein. Gerade bei CF, einem polymorphen genetischen Defekt mit sehr unterschiedlichen gesundheitlichen Folgen, wäre mehr Dosierungsdifferenzierung sinnvoll. VTD wäre eine gute Gelegenheit, damit zu beginnen. Wird das passieren? Ich fürchte, die Antwort schon zu kennen, sie lautet nämlich NEIN. Ich halte dieses gesamte Verabreichungskonzept für mittlerweile reichlich fragwürdig.
Zusatznutzen und Nutzenbewertung: Was bleibt auf der Strecke?
Ich bin gespannt, wie vor dem Hintergrund all dieser komplexen Tatsachen künftig der berühmte „Zusatznutzen“ berechnet wird – im Rahmen der frühen Nutzenbewertung durch das IQWiG und den G-BA nach Erreichen der 50 Mio-Umsatzschwelle, was innerhalb weniger Monate geschehen wird. Ich fürchte, viele dieser Aspekte – von der neuropsychiatrischen Verträglichkeit über die Flexibilität in der Dosierung bis hin zum Umgang mit Nebenwirkungssignalen – werden dabei überhaupt keine Rolle spielen. Für mich wäre das eine ungute Entwicklung. Denn es ist dann natürlich kein Selbstläufer, dass Menschen mit CF von ETI auf VTD umgestellt werden. Diffuse Regressängste, die der Hersteller für unbegründet hält, werden das ihrige tun.
Fazit: Besser? Vielleicht. Differenzierter? Hoffentlich.
VTD ist keine Revolution – aber eine Weiterentwicklung. Es könnte für einige Menschen mit CF leiser, verträglicher, sanfter wirken als sein Vorgänger – außer vielleicht auf die Leber, also auch hier eigentlich wieder die besagte Dosierungsfrage. Wir bräuchten vielleicht weniger „Wucht“, aber mehr Feingefühl.
Ich wünsche mir, dass wir nicht nur auf Wirksamkeit starren, sondern auch lernen, auf Zwischentöne zu achten. Dass Erfahrungswissen nicht abgetan, sondern genutzt wird. Jeder Mensch ist anders – dieser Satz gilt für Menschen mit CF noch mehr! Dass wir Individualisierung zulassen – und nicht alle mit dem gleichen Maß behandeln.
Und vielleicht – ganz vielleicht – ist VTD ja doch der erste Schritt dahin.
*Kai-Roland Heidenreich ist Vorsitzender der Deutschen CF-Hilfe e.V. und Co-Autor der Hustenleitlinie der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie. Seine Lebensaufgabe ist seit vielen Jahren die hingabevolle Unterstützung von Menschen mit CF und deren Angehörigen.

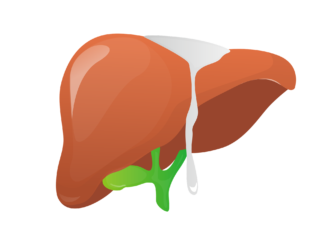


Hinterlasse jetzt einen Kommentar